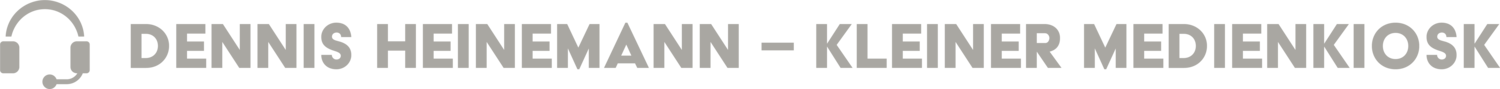Zum Öffnen nach oben streichen
Dienstag, 30. Juni 2020. Ich bin an diesem Tag 31 Jahre alt und ungebunden. Letzteres ist nicht ganz unwichtig. Mit zwei meiner Vorgesetzten sitze ich in der letzten Ecke des Erdgeschosses an einem Tisch. Das Gebäude, in dem wir uns befinden, ist eigentlich zu modern für eine Behörde. Es gibt Büros mit Glasfronten. Und trotzdem ist es kühl. In wenigen Minuten werde ich meine Entlassungsurkunde in den Händen halten und damit bewusst von meinem vorgezeichneten Lebensweg abkommen. Du liebe Güte, das klingt dramatisch. Und wunderschön. „Du wirst Dir das schon gut überlegt haben“, wurde mir zuletzt oft gesagt. Geht so. Meinen Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis habe ich acht Tage zuvor abgegeben. Ohne richtigen Plan B. Es fühlte sich weder so an, als hätte ich mir das äußerst gut überlegt noch als hätte ich es gut vorbereitet. Trotzdem so, als wäre es ein Fehler, es nicht zu tun. Es gibt manchmal Punkte im Leben, an denen es nicht weitergeht. Es ist wie bei Beziehungen, die nicht mehr funktionieren. Irgendwann sagt jemand: „Es geht einfach nicht mehr.“
Um meinen Entschluss zu erklären (was ich nicht müsste, aber doch irgendwie möchte), setze ich etwas früher an. Im Jahr 2008 war ich ein 19-Jähriger mit zu langen Haaren. Meine Frisur, die diesen Namen kaum verdient hatte, ging Hand in Hand mit meiner Lebensvorstellung, vereint durch Undefinierbarkeit. Ich verspürte keinen Drang, mir die Frage zu beantworten, was ich wirklich machen möchte. Ich lebte in der Gegenwart und meine Haare taten das auch. Aber mit meiner Bewerbung bei der Polizei hatte ich plötzlich Aussicht auf Struktur. Aussicht auf einen außergewöhnlichen Job, auf gutes Gehalt und auf Sorgenfreiheit. Schnell bewerben, Querdenker- Selbstfindungs-Phasen keine Chance geben, nicht lange fackeln. Sorgenfreiheit ist aber nur so lange sorgenfrei, bis sie selbst zur Sorge wird. Das mag fast arrogant gegenüber denjenigen klingen, die sich vor Sorgen kaum retten können, trotzdem ist an dem Gedanken etwas dran. Das Beamtenkonstrukt ist ein krisensicheres und transparentes Lebenszeitmodell, das vielen Menschen genau die Sicherheit gibt, die sie brauchen. Nahezu fabelhaft. Und ich gebe zu – auch ich habe es genossen, schon früh auf eigenen Beinen gestanden zu haben. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es in Zukunft mehr von denjenigen geben wird, die ein Lebenszeitmodell zu einem Lebensabschnittsmodell machen wollen. Und ich weiß auch warum: Die Dinge haben sich geändert.
Die Zeiten, in denen ein Beruf erlernt und dann ein Leben lang ausgeübt wurde, neigen sich dem Ende entgegen. Das basiert in meinen Augen zu einem großen Teil auf der Digitalisierung und der damit verbundenen Geschwindigkeit. Es ist doch so: Wenn mein Gesicht mein iPhone entsperrt, was ohnehin schon verrückt ist, steht unten auf dem Bildschirm: Zum Öffnen nach oben streichen. Das Tor zur Welt ist heute also nur noch eine Wischgeste. Der Arbeitsmarkt ist längst nicht mehr so gradlinig wie früher, eher voller Nischen. Es geht viel mehr um Leidenschaften als um Schulnoten.
Die meisten Menschen, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie von meiner Entscheidung hören, sind älter als ich. Die Jüngeren können meine Gedanken absolut verstehen. Manchmal fühlt es sich so an, als hätte ich genau auf einer Grenze gestanden. Konservative Sicherheit oder neue Welt? Ich weiß, dass an der voranschreitenden Technik nicht alles toll ist. Es gibt sogar Situationen, in denen ich mir wünsche, dass der technische Ist-Zustand eingefroren werden würde. Denn je mehr Zeit vergeht, desto schneller kommen und gehen die Trends. Dieser Blog ist ein gutes Beispiel. Wer liest heute noch Blogs? Wer hört in 3 Jahren noch Podcasts? Aber wäre dann alles gesagt? Geredet wird immer. Auch den Behörden würde es gut tun, wenn die Technik mal etwas vom Gas gehen würde. Das Problem ist bloß, dass sie das nicht tun wird. Ein Tempolimit auf der Datenautobahn steht eher nicht zur Debatte.
Ein Freund hat mal gesagt, dass wir alle in gewissem Maße nach Selbstverwirklichung streben. Ich bin kein Fan von großen Motivationsreden und dem überdrüssigen You-can-make-it-happen- Gelaber, stimme ihm in diesem Punkt aber zu. Um die Selbstverwirklichung ausleben zu können, müssen wir aber erstmal wissen, wo die kleine Flamme, die in uns allen lodert, genau ist. Wie soll ich mich selbst verwirklichen, wenn ich gar nicht weiß, was meine großen Leidenschaften sind? Bei mir war das ein jahrelanger Prozess. Ok, Sport war immer ein großes Ding. Aber als klar war, dass ich kein Profisportler werden würde, habe ich es mir auf meiner Couch in der Komfortzone gemütlich gemacht. Ich bereue das alles nicht bis ins Letzte, aber es ist schon so, dass ich meine Entscheidung auch mit Mitte 20, anstatt mit Anfang 30 hätte treffen können. Und das ist es auch, was ich mit diesem Text sagen will: Wer so deutlich spürt, dass er in einem Bereich falsch ist und täglich das Passwort „Kündigung2020!“ in die Tastatur hämmert, sollte sich in einer Welt voller Möglichkeiten nicht in Träumen verlieren. Klar braucht es Mut und Selbstvertrauen, aber wer von uns würde denn ernsthaft Gefahr laufen, unter ’ner Brücke zu enden? Ich komme an diesem Punkt nicht drum herum, Matze Rossi in seinem Song OhOhOh zu zitieren, in dem er singt: „Ich bleib‘ in Bewegung, ich will nicht stillstehen. Denn ich weiß genau, Stillstand ist wie tot sein.“
Und so sitze ich da am 30. Juni 2020 mit meinen beiden Vorgesetzten am Tisch. Der Ranghöhere ergreift das Wort und betont nochmal, wie ungewöhnlich meine Entscheidung sei und dass es uns Beamten in Corona-Zeiten doch wirklich gut gehe. Dass es ein Luxus sei, die Gewissheit zu haben, absolut sicher zu sein. Natürlich hat er damit Recht und ich verüble ihm das auch nicht. Trotzdem falle ich ihm mit einem Satz ins Wort, der mir bis heute im Kopf herumschwirrt. Ich sage: „Verstehe ich alles, aber ich bin nicht nur auf der Welt, um zu überleben, sondern um gerne zu leben! Und jetzt her mit der Urkunde.“
Das mit der Urkunde am Ende habe ich nicht gesagt – das andere schon. Und dann war ich weg.